Nicht nur Demokraten sangen und kreischten in der Nacht vom 4. auf den 5. November 2008: „Obama won!“ Der Mehltau der Bush-Jahre schien im Nu wie weggepustet, Liedermacher legten sofort mit neuen Lobgesängen auf Obama los und ganz Berkeley, Cal. schien den ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt zu haben. Sowjetische Wahlergebnisse in den damals noch freien USA.
Schon lange bevor die Demokraten Barack Obama und dann Joe Biden lhre Hilflosigkeit demonstrierten, im hochkapitalistischen Tech-Land USA eine gerechtere Gesellschaft und eine solidarischere obendrein zu gründen, war der gesellschaftliche Zusammenhang zwischen arm und reich, gläubig und ungläubig und nicht zuletzt zwischen Schwarz und Weiß, zerrissen. Ohne dieses Band aber kann Demokratie, soll sie nicht nur rein formal sein, nicht überleben. Das erkennen wir heute.
Das Verschwinden des gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, den die Ostküsten- Zeitungen und Magazine andauernd beklagen und der sich in der Gesundheitsgesetzgebung, der Alters- und Rentengesetzgebung widerspiegelt, macht in Wirklichkeit aus den meisten Menschen im Land keine stolzen Individualisten, sondern eher angstbesetzte Vereinzelte, auf sich allein zurückgeworfene Einsame.
Wie unrecht habe ich damals doch dem ansonsten von mir hoch verehrten Gonzo - Journalisten und Schriftsteller Dr. Hunter S. Thompson getan! Als ich vor Jahren den Titel seiner Autobiographie las, schmiss ich das Ding sofort in den Eimer: „Königreich der Angst“ bespottete er die USA. „Die hervorstechendste Qualität des Lebens in Amerika unter Bush ist - nach allen nachvollziehbaren Kriterien - dass das Leben unter Nixon ganz zweifellos freier und politisch offener war als heute." Das hielt ich für absoluten Unfug. Schlimmer als Nixon! Hätte ich es doch gelesen, so viel Wahrheit liegt darin. Als ich 2008/2009 in Berkeley und San Francisco lebte, erkannte ich das Land nicht wieder, in dem ich 1977/79 schon einmal gelebt und studiert hatte. Es war bereits auf den Hund gekommen. Fear and Loathing - nicht nur in Las Vegas. Sondern im ganzen Königreich der Angst.
Doch wo der Staat, wo die Gesellschaft nicht mehr funktioniert, nehmen mitunter einige starke Typen das Heft in die Hand, um Menschlichkeit zu leben. So Stan Brock, britischer Pilot, Philanthrop, Schauspieler, Autor und vor allem Gründer der Organisation RAM (Remote Area Medical).

Eine Hilfsorganisation, die alle paar Wochen irgendwo im Land in Universitäten, Football-oder Basketball-Hallen, Massen OPs, Zahn-OPs, Sehhilfen etc. organisieren - kostenlos für die Patienten. Sämtliche Beteiligte - die wechselnden Ärzte, Krankenpfleger, Hilfskräfte wurden von RAM eingespannt. Keiner verlangt Honorar oder auch nur Unkostenerstattung. Kein Wunder, dass junge und alte Arme, ob in Los Angeles, Kentucky oder New York oft schon drei Tage vorher auf Parkplätzen anstehen, um Hilfe suchend. Tausende, überall. Sie alle haben keine Gesundheitsversicherung, können sich eine ärztliche Behandlung nicht leisten.
Doch die Elendsviertel in den USA wuchern immer weiter. In Motorcity Detroit beispielsweise verwahrlost das frühere Villenviertel direkt neben Downtown schneller als die Autos von den Fließbändern von Ford, GM oder Chevrolet rollen. Die Gegend ist unbegehbar, „Aggressive Criminal Lawyers“ haben ihre Filialen aufgebaut, um die Villen-Gerippen zu schützen, Post wird dort keine mehr ausgetragen. Auch nicht per RAM-Flieger. Der in den 50er und 60er Jahren florierende Mittelstand ist in vielen Städten der USA längst unter die Räder geraten. Aus jenen Boom-Zeiten stammt der ironisch-Zynische Spruch: „The future is bright. We gotta wear shades.“
„Ich hatte zuvor Flüge in die Armenregionen Lateinamerikas unternommen, auch jahrelang mit den Eingeborenen weitab der Zivilisation gelebt, bis mir ein Nachbar sagte: „Warum fliegst du so weit. Hier in den USA gibt es auch viele, denen es mindestens so schlecht geht. Um die aber kümmert sich niemand.“
Ohne Staatsknete, nur mit Miethilfe der Stadt Knoxville baute er diese Hilfsorganisation auf. „Natürlich ist das kein Ersatz für ein funktionierendes Gesundheits- oder Sozialsystem. Aber man tut eben, was man kann.“
Auch in Stockton, Cal. ist die Zukunft längst passé. Dort hatte ein findiger Immobilien-Verkäufer 2008 im Zuge der großen Wirtschaftskrise mit viel Erfolg eine perfide Attraktion erfunden, die „REPO-TOUR“, also „Repossession-Tour“ erfunden. Regelmäßig lädt er Kaufwillige oder scheinbar Kaufwillige wie mich zur Besichtigungstour durch die seit der Finanzkrise 2008 von einem Tag auf den anderen herrenlos gewordenen Häuser der kalifornischen suburbs. Die ehemaligen Besitzer konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen, sodass sie ruckzuck obdachlos wurden. Obwohl man in einigen dieser oft schäbigen, dünnwändigen Wackel-Buden noch das frühere Leben der Bewohner an Geruch, Tapeten etc. erahnen kann, gehen diese scheinbaren Schnäppchen in den regelmäßig stattfindenden Auctions wie warme Semmeln über den Tisch. Der beliebteste und kennzeichnendste Spruch für das amerikanische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem scheint wie eine unsichtbare Tapete alle Ritzen zu überziehen: „The winner takes it all.“
Doch während den stundenlangen Auktionen, bei denen in großen Hallen hunderte von Häusern am Fließband vertickt werden, fragt man sich unwillkürlich: Who´s the winner? Die Immobilien-Händler? Die Neukäufer, das Finanzamt? Die Stadt Stockton? Die Banken? Die Aufzählung so vieler möglicher Profiteure der Armut zeigt, dass die Frage falsch gestellt ist. Sie muß lauten: Wer sind die Verlierer? Die Antwort darauf ist viel einfacher zu haben: Die mittels unrealistisch günstiger, hoher Kredite in die teuren Eigenheimen gelockten Kreditnehmer. Diese haben nicht nur ihr Zuhause verloren. Oft auch Jobs, Gesundheit, Freunde und sogar ihre Familie.

Verlierer überall. Auf dem Weg in die Drogenkapitalen Mexikos, die die USA in gigantischen Dimensionen mit Drogen versorgen, musste ich in San Diego einen halben Tag auf einen Anflugschluss nach Tucson warten. Es war nicht das erste Mal. Doch diesmal hatte die Fluggesellschaft den Flug in die Wüste Arizonas 7mal überbelegt. „Ja, Ja: Scheiß-Amiland, nicht wahr?“ pflichtete der freundliche Mann vor mir scheinbar bei, als ich erst aufstöhnte, dann wütend loswetterte. Er war der Pilot. Zuerst dachte ich, der durch vollen Fliegerwichs legitimierte Herr wolle sich ironisch über meine „Vorurteile“ lustig machen. Aber, weit gefehlt. Der kluge Mann hatte ein Jahr in Düsseldorf gelebt und kam zu dem Schluss: „Das haben wir der extremen Deregulierung seit Reagan, dann Bush zu verdanken. Deregulierung heißt: Wir können mit Euch machen, was wir wollen! Verbraucherschutz, unbedingt ja! Aber doch nicht im Zeitalter der Deregulierung.“
Dabei brechen sie noch immer viele Rekorde hier in God´s Own Country. Ohne Superlative kein Leben. Sie schwelgen hartnäckig weiter über ihr Land. Kein Wunder: Alles ist ja „Great!“, „Awesome!“, „Far out!“, „Phantastic!“ oder „Something else!“. Muss es ja auch im Land der doch völlig unbegrenzten Möglichkeiten. Eine gigantische gesellschaftliche Autosuggestion. Denn es ist die Angst vor der Arbeitslosigkeit, der Verarmung, der Obdachlosigkeit, die diese Art Voodo-Glaube an die „Größe“ der USA schürt. Das sind Mittelklasseängste, nicht die Existenznöte derjenigen, die längst ohne Obdach am Boden liegen. Denn sie wissen: auch für sie gibt es kein soziales Rettungsseil, wenns plötzlich mal bergab geht.
Während ich das damals notierte, bekomme ich eine entschuldigende Email von Bob, einem langjährigen, sehr guten Studien-Freund aus Iowa City, der lange nichts von sich hat hören lassen. „Vor zwei Wochen hat sich mein junger Bruder aufgehängt. Er war tief verschuldet, hatte seinen Job verloren, dann sein Haus.“
Eingroßes, immer aktuelles Thema: Down and Out in the USA. Drei gigantische Überängste durchwirken viele Existenzen: Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter. Wer dem nicht in tiefer Verzweiflung entgegen schauen möchte, muß kräftig vorsorgen. Das Morgen ist aber nichts für eine Gesellschaft, denen die Forderungen des Tages schon Plackerei genug ist.
Womöglich aber sind die Amerikaner die einzig radikalen Buddhisten dieser Welt! Keine Gesellschaft lebt so sehr im „Hier und Jetzt“ wie die amerikanische. Nirgendwo kann man so früh in der Schule Geschichte abwählen (oder gar nicht erst belegen wie unsere Tochter Carlotta auf der Berkeley High School). Die Vergangenheit ist stets eine vollendete, spurlos verschwunden. Und die Zukunft? Offen, ungewiss und nie vorhersehbar.
Der US-Buddhismus predigt: „I want the world - and I want it now!“
Dabei will die halbe Welt die ganze Welt. Auch William.
William ist der beste, wirklich beste Autoverkäufer Oaklands, Cal., vielleicht der halben Welt. Der freundliche Mann aus Hongkong ackert seit 28 Jahren mindestens zwölf Stunden bei einem Autohändler in der Nachbarstadt Berkeley, einer schwer von Kriminalität gezeichneten Multi-Kulti-Stadt. William hat die Studiengänge seiner beiden Söhne finanziert, nie Urlaub gemacht. Er arbeitet jeden Samstag, und auch sonntags dealt er mit Autos. Er wohnt im Süd-Westen von San Francisco, Daley City, wo die Nebelbänke am dichtesten und kältesten sind - dafür die Mieten am niedrigsten. Viele Chinesen, Koreaner und auch Japaner wohnen hier, seitdem der Immigration und Nationality Act ihnen im Jahre 1965 den Aufenthalt ermöglicht. Sie eint nicht nur die harte Gegenwart, nicht nur ihre Herkunft aus Asien.
Sie alle eint ein Traum: eine Zukunft haben. Zuhause. Genug Geld zu verdienen, um Rente und Gespartes in Hongkong oder Korea oder Taiwan aufbrauchen zu können. In der Familie! Vor der eigenen Hütte sitzen! Egal wie klein.
40 bis 50 Jahre Maloche müssten das doch ermöglichen! „Ich kann es nicht mehr abwarten. Wegen der Krise muss ich aber noch zwei, drei Jahren länger ackern als geahnt. Dann ist es bestimmt so weit. Dann kehre ich mit meiner Frau zurück - und lebe von meinen beiden studierten Kindern,“ macht er sich Mut. Dann ist wieder alles im Lot. Dann hat sich die lebenslange Plackerei in der Fremde gelohnt. Dann haken sie Amerika wie ein notgedrungenes Übergangsritual ab.
Auch für mich und meine Familie, Andrea und Carlotta, war die Zeit in Berkeley, California ein Übergangsritual. Ein tolles, das keiner missen möchte. Wie immer sind es die Menschen, die Freunde, Nachbarn und Wegbegleiter, die ein inneres Band zu einem Land oder einer Stadt knüpfen. Es war vielleicht die wunderbarste Nachbarschaft, die wir je hatten, dort oben über Berkeley und der Bay, bei Grizzly Peaks und Loki, der schönsten Katze der halben, wenn nicht gar der ganzen Welt.
%20copy.jpg)
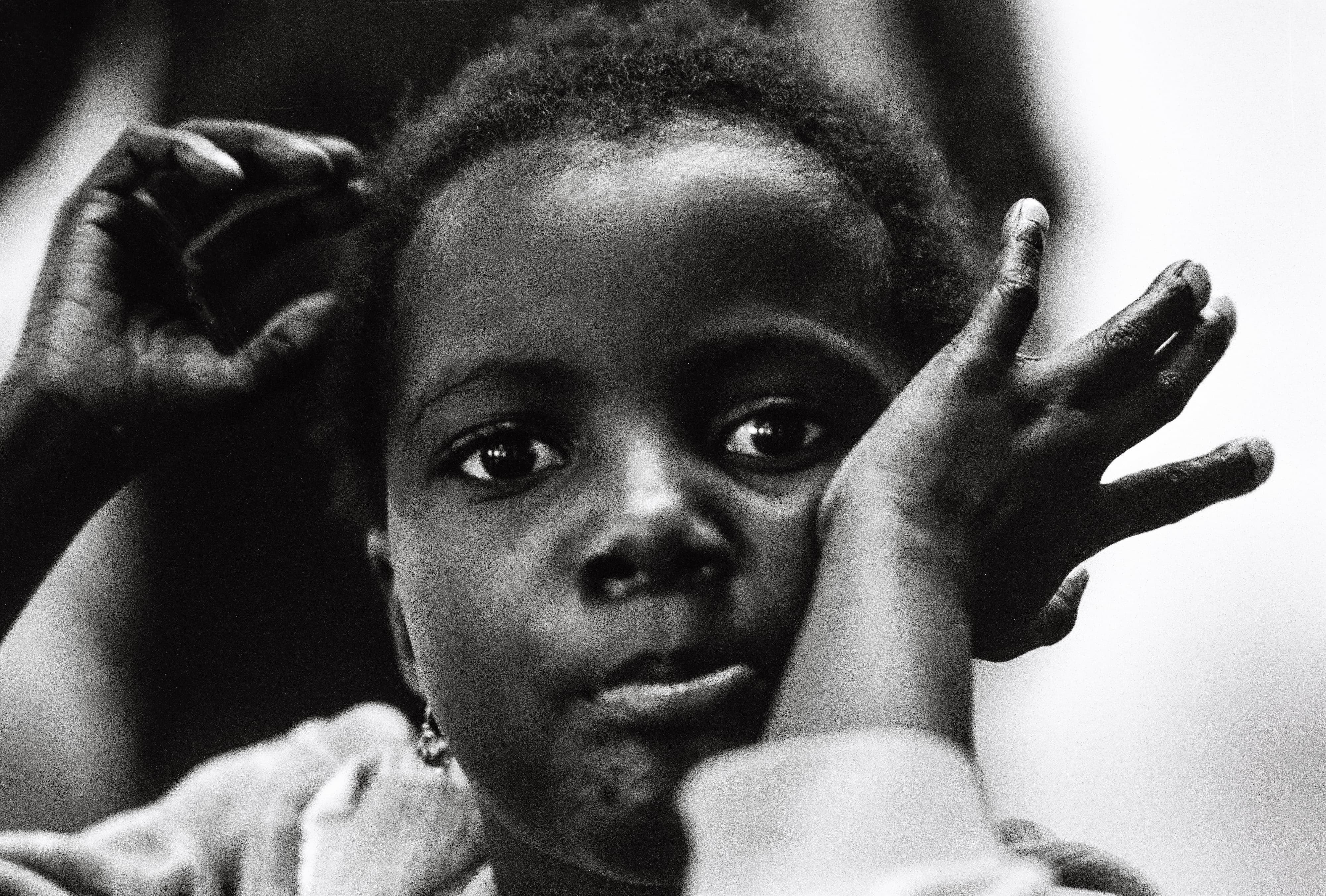




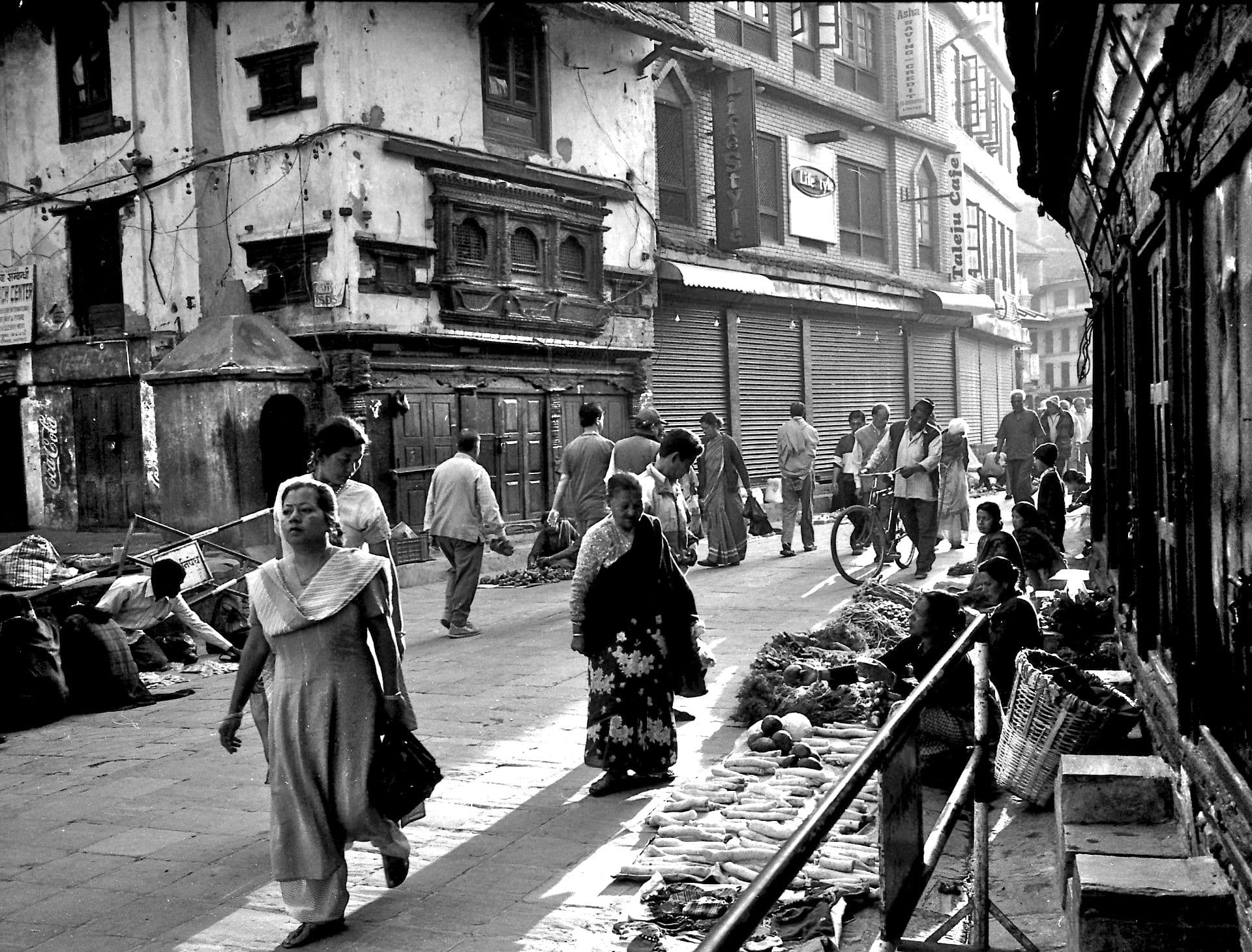

.jpg)